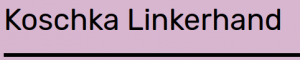 Nachfolgend dokumentieren wir den Text “Mitten unter uns Überlegungen zum transnationalen Kampf gegen Femizide” von Koschka Linkerhand. Zuerst erschienen in der konkret 8/20 und 9/20 (August und September 2020). Mehr von Koschka Linkerhand findet ihr auf: http://koschkalinkerhand.de/
Nachfolgend dokumentieren wir den Text “Mitten unter uns Überlegungen zum transnationalen Kampf gegen Femizide” von Koschka Linkerhand. Zuerst erschienen in der konkret 8/20 und 9/20 (August und September 2020). Mehr von Koschka Linkerhand findet ihr auf: http://koschkalinkerhand.de/
Mitten unter uns. Überlegungen zum transnationalen Kampf gegen Femizide
Koschka LinkerhandTeil 1
Am 8. April 2020 wurde in Leipzig die 37-jährige Myriam Z. ermordet, mutmaßlich von ihrem Expartner. Sie war mit ihrem Baby im Auwald spazieren, einem Waldstück, das im Frühling 2020, während der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen, zu jeder Tageszeit voller Menschen war. Der Täter fügte Myriam Z. so starke Kopfverletzungen zu, dass sie tags darauf starb. Ihr Baby blieb unverletzt. In den folgenden Tagen war – trotz Versammlungsverbots – von feministischer Seite viel zu hören und zu sehen: Unterführungen, die in der Nähe des Tatorts in den Wald hineinführten, wurden mit weißer Farbe bestrichen, um Platz für Trauerbekundungen und politische Forderungen zu schaffen. In diesen wurde betont, dass der Mord ein Femizid war – ein Frauenmord, ermöglicht durch strukturelle patriarchale Gewalt. Entsprechend erschienen auf den geweißten Wänden die Losungen des transnationalen feministischen Kampfs gegen Femizide: „Keine mehr – Ni una menos – Non una di meno!“ Daneben fanden sich Aussagen wie „Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex-)Partner ermordet“ und „Femizid hat kein Herkunftsland“. Die Forderung „Schützt eure Töchter!“ wurde durchgestrichen und durch „Erzieht eure Söhne!“ ersetzt.
An mehreren Orten knoteten Aktivistinnen weiße Bändchen an Brückenpfeiler und Zäune: eins für jede Frau, die in Deutschland einem Femizid zum Opfer gefallen ist. Am 16. Mai veranstaltete ein feministisches Bündnis unter dem Slogan „Das Private bleibt politisch!“ am Tatort eine Kundgebung mit anschließender Demonstration. Bereits seit Bekanntwerden des Mordes wird der Tatort mit Transparenten, Blumen und Kerzen als Gedenkort gepflegt. In der unmittelbaren Umgebung erschienen weitere Transparente, Plakate und Graffiti, klärten über den Femizid auf und enthielten – teils mehrsprachig – Hinweise für Opfer sowie Zeug_innen häuslicher Gewalt. Zwei Redakteurinnen der feministischen Zeitschrift outside the box konnten der täterzentrierten Berichterstattung von BILD und Leipziger Volkszeitung einen Jungle World-Artikel über den Femizid entgegenstellen. Zur selben Zeit berichteten überregionale Medien über die durch die Ausgangsbeschränkungen zu erwartende Zunahme häuslicher Gewalt und über entsprechende Hilfsangebote – ein Erfolg jahrzehntelanger feministischer Aufklärung. Die explizit gegen Femizide gerichtete Aufklärung hat vor einigen Jahren die Initiative #KeineMehr angestoßen. Sie setzt sich für die Verwendung des Begriffs in der Berichterstattung sowie für eine entsprechende Erfassung in der Kriminalstatistik ein. Im Zuge des Femizids an Myriam Z. gründete sich eine Leipziger Ortsgruppe, um weitere Fälle zu dokumentieren und inner- wie außerhalb der linken Debatte über Femizide aufzuklären.
Der Begriff femicide wurde 1976 von der US-amerikanischen Aktivistin Diana Russell geprägt und ist seither vor allem in lateinamerikanischen Ländern zum Kampfbegriff geworden. In Mexiko oder Argentinien bringen Demonstrationen gegen Frauenmorde, gegen nachlässige polizeiliche Ermittlungen und für Strafverschärfungen Zehntausende auf die Straßen. Die Lo-sung Ni una menos! („Nicht eine weniger!“) verweist auf die kollektive Morddrohung, der Frauen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit ausgesetzt sind: vonseiten ihrer Partner, Expartner oder Väter, aber auch von ihnen unbekannten Vergewaltigern, Serienmördern oder dem organisierten Verbrechen. #KeineMehr fasst die Drohung, die nur für einige Frauen wahr wird, aber alle meint, so zusammen: „Frauen* werden getötet, weil sie Frauen* sind.“
Der Kampf gegen Femizide beruft sich somit auf eine entscheidende Gemeinsamkeit innerhalb der weiblichen Subjektposition im kapitalistischen Patriarchat. Femizide sind die extreme Zuspitzung einer Kette von patriarchalen Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen – eine Kette, die u. a. über sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit, Stalking, häusliche Gewalt und Vergewaltigung reicht. Das Phänomen ist, wie bereits Diana Russell feststellte, „as old as patriarchy“, verschärft sich aber in gesellschaftlichen Krisensituationen wie der Corona-Pandemie. So kritisiert das Transnationale feministische Manifest, das von feministischen Gruppen aus lateinamerikanischen und europäischen Ländern unterzeichnet wurde, dass die aufgrund der Pandemie verhängten Ausgangssperren Frauen auf den häuslichen Raum verwiesen. Damit war ein erhöhtes Maß an reproduktiven Tätigkeiten verbunden (wie die Versorgung der Kleinfamilie und Home-Schooling), während gleichzeitig die Gewalt durch Ehemänner und Väter zunahm. In einer gesellschaftlichen Krisensituation auf die patriarchalen Geschlechtscharaktere zurückgeworfen zu werden, endet für Frauen im schlimmsten Fall darin, Opfer eines Femizids zu werden.
In Mexiko wurden allein für den April dieses Jahres 377 Morde an Frauen statistisch erfasst – die höchste Zahl seit Beginn der Erfassung von Femiziden im Jahr 2012. In der Statistik des BKA, die seit 2015 die (zumeist weiblichen) Todesopfer partnerschaftlicher Gewalt verzeichnet, wurden für dieses Jahr bis Ende April 65 von ihrem Partner oder Expartner getötete Frauen gezählt; für das gesamte Jahr 2019 waren es 135 Morde.
Die feministische Besinnung auf globale Gemeinsamkeiten des Subjekts Frau trägt dazu bei, Femizide zu politisieren. Sie hilft, ein Bewusstsein für die patriarchale Gewalt zu wecken, sich dagegen zu solidarisieren und Staat und Öffentlichkeit unter Druck zu setzen. In verschiedenen Ländern Lateinamerikas – wie Mexiko, Argentinien, Uruguay – haben feministische Kämpfe erreicht, dass Femizid als Straftatbestand bzw. strafverschärfendes Merkmal in die Gesetzbücher aufgenommen wurde. Die gesellschaftliche Leugnung des Phänomens ist damit nicht vorüber: Die mexikanische Frauenrechtlerin Ana María Hernández kritisiert, dass von den 377 Frauenmorden im April 2020 nur 70 Fälle als Femizide kategorisiert werden. Dennoch setzt die Aufnahme von Femiziden in die Gesetzbücher sowie in die Berichte der Weltgesundheitsorganisation auch für die feministische Diskussion in Deutschland ein Fanal.
Ni una menos als Massenbewegung entzündete sich 2015 in Argentinien am Mord an der 14-jährigen Chiara Páez. Sie wurde von ihrem Freund erschlagen, der sie anschließend mit Hilfe seiner Familie vergrub. Hunderttausende gingen auf die Straße, weil mitten unter ihnen ein junges Mädchen getötet worden war, das den Forderungen eines Mannes eine eigenständige Entscheidung entgegengesetzt hatte: Chiara Páez hatte sich geweigert, eine Abtreibung vornehmen zu lassen.
Myriam Z. hatte sich von ihrem späteren mutmaßlichen Mörder getrennt und mit einem anderen Mann ein Kind bekommen. Obwohl dieser Mord mitten unter uns geschehen ist, gibt es in Deutschland außerhalb feministischer Zusammenhänge noch keine vergleichbare öffentliche Empörung, kein breites Bewusstsein für die potenziell gegen alle Frauen gerichtete Vernichtungsdrohung. Um das zu verstehen, müssen die Differenzen zwischen den feministischen Bewegungen in Lateinamerika und Deutschland ins Auge gefasst werden.
Die große feministische Theoretikerin Silvia Federici führt in Die Welt wieder verzaubern aus, wie im globalen Süden das kapitalistisch-patriarchale Geschlechterverhältnis durch neokoloniale Ausbeutung verstärkt wird. Das trifft schwarze und indigene Frauen mit besonderer Härte. Die permanente ökonomische Unsicherheit eines großen Teils der Bevölkerung verstärkt laut Federici einerseits den Machismo, der sich in physischer und sexueller Gewalt gegen Frauen äußert. Andererseits verhindert sie die bürgerliche Verdrängung der reproduktiven Arbeiten in den privaten Raum, wo sie von voneinander isolierten Frauen verrichtet werden. Die Frauen drängen mit ihren Problemen und Diskriminierungserfahrungen in die Öffentlichkeit und werden zu Vorreiterinnen sozialer Kämpfe – „weil es nichts gibt, worauf sie sich verlassen können, und alles andauernd verhandelt werden muss, Kämpfe erfordert und auch gleich wieder zu verteidigen ist.“ Diesen alltagsnahen, dezentralen Feminismos populares liegt die Erfahrung zugrunde, dass Frauen sich in Communitys und Nachbarschaften autonom organisieren müssen, um sich gegen den Zugriff von Staat und Großkonzernen zu wehren.
Die Militärdiktaturen etwa in Chile oder Argentinien haben den Staat als Täter und Vergewaltiger ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, wie es auch in der Protestperformance Un violador en tu camino („Ein Vergewaltiger auf deinem Weg“) der chilenischen Aktivistinnengruppe Las Tesis heißt, die transnationale Berühmtheit erlangte. Parallel zu ihrer Verwurzelung in den Feminismos populares beziehen sich Las Tesis ausdrücklich auf akademische Feministinnen wie Rita Segato, die als Anthropologin an der Universität Brasília lehrt und von feministischen Kollektiven auf dem ganzen Kontinent diskutiert wird.
In vielen Kämpfen lateinamerikanischer Feministinnen zeigt sich ein spannendes Paradox: Im Bemühen, ihre Familien zu versorgen, also ihren reproduktiven Verpflichtungen als Frauen nachzugehen, werfen Aktivistinnen grundsätzliche Fragen nach nicht-mehr-kolonialen oder -kapitalistischen Wirtschafts- und Lebensweisen auf, in denen Frauen nicht auf die patriarchale Rolle als Fürsorgerin und Elendsverwalterin abonniert wären. Ein zweites Paradox liegt in der Gleichzeitigkeit zweier Stoßrichtungen: Einerseits kämpfen Feministinnen (vor allem indigene) gemeinsam mit den Männern ihrer Communitys gegen den Staat, andererseits gegen die Männergewalt in den eigenen Ehen und Familien. Die Konflikte liegen sozusagen offen auf der Straße – und können gemeinsam verhandelt werden. Die allermeisten Frauen sind alphabetisiert und haben Zugang zu städtischer Infrastruktur, Medien und Kommunikationstechnologien. Neben der Kolonialgeschichte und der ähnlichen Position lateinamerikanischer Staaten in der internationalen kapitalistischen Arbeitsteilung begünstigt der spanische Sprachraum den gemeinsamen politischen Bezugsrahmen.
Obwohl die Frauenmord-Statistiken von Mexiko und Deutschland nicht unmittelbar vergleichbar sind, lassen sie erkennen, dass die Femizidrate Mexikos weitaus höher ist als die deutsche. Nach einem Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von 2016 hat Honduras die weltweite höchste Rate an Femiziden, die von (Ex-)Partnern oder Familienmitgliedern verübt werden (15 Morde auf 10.000 Einwohner_innen), während Deutschland mit 0,51 Morden leicht über dem westeuropäischen Mittelwert liegt. Auch ist hierzulande die organisierte Kriminalität kein vergleichbar großer Faktor hinsichtlich der Ermordung von Frauen.
Angesichts der besonderen gesellschaftlichen Voraussetzungen, denen die weibliche Subjektivität in Lateinamerika unterliegt, verwundert es nicht, dass wichtige Anstöße für feministische Bewegungen überall auf der Welt heute aus Lateinamerika kommen: die Forderung nach einem Frauenstreik, der Kampf für das Recht auf Abtreibung und gegen Femizide.
Eine breite feministische Selbstorganisation über Communitys und auch Generationen hinweg ist in Deutschland derzeit nicht in Sicht. Den Feminismos populares steht der institutionalisierte Feminismus der Frauenhäuser und -beratungsstellen sowie der Gleichstellungsbüros gegenüber, die von Staatsgeldern abhängig sind und ihren feministischen Aktionsradius in einem kräftezehrenden Balanceakt ausloten müssen. Genauso wie der akademische Feminismus hierzulande – eine weitere Errungenschaft der Zweiten Frauenbewegung – sind feministische Institutionen an ihrer Bestandssicherung interessiert und müssen fortwährend ihre Systemrelevanz unter Beweis stellen. Das hegt den emanzipatorischen und staatskritischen Elan unvermeidlich ein. Dazu kommt, dass die feministische Theoriebildung an deutschen Universitäten nicht mehr eng mit feministischem Aktivismus verbunden ist und überdies den Bezug zu den „gelebten Realitäten von Frauen und Mädchen“ (Mona Eltahawy) verloren hat. Analog beschränken sich viele Spielarten von Aktivismus auf einen kleinen, subkulturellen Rahmen und haben sich ihrerseits von der theoretischen Auseinandersetzung entfernt.
Die Diskussion über Femizide, die in Deutschland langsam anläuft, bietet einen guten Anlass, sich über die materiellen und ideellen Bedingungen feministischer Bewegungen klar zu werden und auf dieser Grundlage den eigenen politischen Handlungsspielraum abzustecken und zu erweitern. Aus der Perspektive feministischer Theoriebildung muss es darum gehen, die Verbindung zu einem zielgerichteten Aktivismus, einer welthaltigen feministischen Praxis wieder zu vertiefen. Das Thema Femizide zeigt besonders eindrücklich: Feministische Theorie muss getragen sein vom Willen, die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen Frauen, Mädchen, Queers und rassistisch Verfolgte leiden, zu verändern. Ein gutes Beispiel bietet, neben den alten und neuen Schriften Silvia Federicis, der Band Femicide. The Politics of Woman Killing, den Diana Russell und Jill Radford 1992 herausgegeben haben. Genauso unverzichtbar ist es, die Erfahrungen und Analysen lateinamerikanischer Autorinnen wie Rita Segato und Marcela Lagarde y de los Ríos heranzuziehen.
#KeineMehr hat begonnen, die Arbeiten einiger Autorinnen und Kollektive zu rezipieren und zu übersetzen. Daran gilt es anzuknüpfen und sie im Sinne einer feministischen Subjekttheorie und -kritik weiterzudenken. Völlig klar ist, dass das Ziel einer feministischen Femizid-Forschung in der Politisierung und Abschaffung dieser Morde liegt, die mitten unter uns stattfinden und grundsätzlich jede Frau treffen können.
Teil 2
Am 8. April 2020 wurde in Leipzig die 37-jährige Myriam Z. ermordet, mutmaßlich von ihrem Expartner. Sie war mit ihrer zwei Monate alten Tochter auf einem Spaziergang, als der Täter sie überfiel und ihr so schwere Kopfverletzungen zufügte, dass sie tags darauf starb. Das Baby blieb unverletzt. Am 21. Mai 2020 wurde in der iranischen Stadt Talesch die 13-jährige Romina Ashrafi ermordet. Sie war mit einem 35-Jährigen, der ihr die Ehe versprochen hatte, von zu Hause weggelaufen, wurde von der Sittenpolizei verhaftet und ihrem Vater übergeben, der sie im Schlaf mit einer Sichel enthauptete.
Beide Frauen wurden von Männern getötet, die sich durch familiäre oder (ehemalige) Liebesbande für berechtigt hielten, sie zu ermorden. „Frauen* werden getötet, weil sie Frauen* sind“, schreibt die Initiative #KeineMehr. Gleichzeitig offenbaren die beiden Fälle, dass das gesellschaftliche Frausein mit sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Gefährdungsgraden verbunden ist. In den Statements von #KeineMehr soll das inkludierende Sternchen etwa die Differenzen in der Tötung von cis und trans Frauen, von Prostituierten oder nichtweißen Frauen repräsentieren. So werden Morde an schwarzen oder indigenen Frauen oft kaum strafrechtlich verfolgt; während getötete trans Frauen häufig nicht in die Frauenmord-Statistiken eingehen.
Femizide machen die großen Unterschiede innerhalb des globalen Subjekts Frau, aber auch eine entscheidende Gemeinsamkeit deutlich: die konstitutive Vernichtungsdrohung im Fall, dass Frauen sich zu viel Autonomie anmaßen, also nach der Ansicht eines Mannes bestimmte weibliche Rollenerwartungen verfehlen. Diese These will ich mit den Mitteln feministischer Subjektkritik ausführen. Damit meine ich hier, die geschlechtsspezifischen Handlungsspielräume und Freiheitsmöglichkeiten von Frauen im kapitalistischen Patriarchat zu skizzieren und sie in Beziehung zu einer Theorie des bürgerlichen Subjekts und seiner Abspaltung des Weiblichen zu setzen.
Myriam Z. hatte sich von Edris Z. getrennt und ein Annäherungsverbot wegen Stalkings gegen ihn erwirkt. Die Gleichstellung der Geschlechter im deutschen Recht machte es Myriam Z. möglich, ihren Expartner selbständig anzuzeigen – auf Grundlage des Gewaltschutzgesetzes, das ein Ergebnis jahrzehntelanger Kämpfe gegen häusliche Gewalt ist. Es hat ihr nicht das Leben gerettet. Der aktuelle Stand der Frauenemanzipation in Deutschland hat die gesellschaftliche Ächtung von Frauen, die sich von ihren Männern trennen, weitgehend zu den historischen Akten gelegt. Das verhinderte nicht, dass für den mutmaßlichen Mörder seine Kränkung schwerer wog als Myriam Z.s Leben. Einigen Berichten zufolge erschlug er sie mit einer Bierflasche, nachdem er bereits gegen einen ihrer Bekannten gewalttätig geworden war. Medial wird es hierzulande meist als private „Beziehungstat“ oder „Eifersuchtstragödie“ bezeichnet, wenn eine Frau es in den Augen des Täters nicht verdient hat weiterzuleben.
Das gesellschaftliche Frausein wird wesentlich über die Zugehörigkeit zum Mann und das Verrichten reproduktiver Arbeiten hergestellt: Care-Arbeit zu Hause und im Beruf, das Gebären und Aufziehen von Kindern, Beziehungsarbeit, Schönheit, Gefälligkeit und die sexuelle und emotionale Befriedigung des Mannes. Zugleich sind Frauen in der westlichen Ausprägung des globalen Kapitalismus vollwertige Rechtssubjekte und müssen ihre Arbeitskraft zu Markte tragen – beides klassische Merkmale bürgerlicher Subjektivität. Aufgrund dieser gegensätzlichen Anforderungen bleibt der Subjektstatus der Frauen instabil und wird immer wieder neu verhandelt. Die patriarchalen Rollenanforderungen negieren fortlaufend, dass die Frauen Subjekte sind. Die krasseste, irreversible Negation ist der Femizid: Er verneint, dass eine Frau eine Person mit einem Recht auf ein eigenes Leben ist. Untersuchungen zeigen, dass Frauen, die sich getrennt haben, die ins Arbeitsleben (wieder-)einsteigen oder ein Kind bekommen, besonders gefährdet sind, einem Femizid zum Opfer zu fallen.
In Deutschland beziehen sich Frauen wie Männer stark auf die frauenrechtlichen Errungenschaften der letzten 50 Jahre und leugnen dabei stärker als etwa Lateinamerikanerinnen, dass Femizide eine extreme Zuspitzung des ganz normalen Geschlechterverhältnisses sind. Der Gedanke, dass ein verwandter oder geliebter Mann, ein Mann aus dem Freundeskreis oder dem Kollegium dazu möglicherweise in der Lage wäre, ist kaum erträglich. Es bedarf einer engagierten feministischen Aufklärung und Bewusstmachung, um ihn zuzulassen und einen emanzipatorischen Umgang damit zu finden.
Ein naheliegender Ausweg, um das zu vermeiden, liegt in der rassistischen Externalisierung der Tat: Die mediale Berichterstattung über Myriam Z.s Ermordung war auf den mutmaßlichen Täter konzentriert, der vor allem als gebürtiger Afghane mit Hochschulabschluss und sozialem Engagement beschrieben wurde. BILD und Leipziger Volkszeitung sprachen mit Verwunderung bis hin zu offener Gehässigkeit über den angeblichen Widerspruch zwischen dem „Musterbeispiel für Integration“ und dem brutalen Mord an seiner Exfreundin – als wäre Deutschland ein Geschlechterparadies, in dem nur migrantische Männer Gewalt an Frauen verüben.
Die kulturalistische Erklärung überdeckt die Erkenntnis jahrzehntelanger feministischer Theoriebildung, dass Gewalt gegen Frauen ein strukturelles Problem bürgerlicher Subjektivität ist. Um dauerhaft zu Lohnarbeit, zu persönlicher Autonomie, aber auch zum Gehorsam gegen Gesetze und Vorgesetzte fähig zu sein, muss das Subjekt seine Abhängigkeit von Fürsorge und Zuwendung sowie die Bedürfnisse nach Genuss und Passivität abspalten. Die Frustration, die daraus erwächst, wird in Kontrolle über Frauen und Kinder umgewandelt sowie in Hass auf Homosexuelle, trans Personen und Männer, die als nicht männlich genug oder aus rassistischen Gründen als unterlegen wahrgenommen werden. Im kapitalistischen Patriarchat wird Männern hauptsächlich diese gewaltförmige Subjektivierung angeboten, während Frauen stets mit der doppelten Anforderung konfrontiert sind, Subjekt und gleichzeitig auf Reproduktion verwiesenes weibliches (Nicht-)Subjekt zu sein.
Die bürgerliche Subjektform ist die Grundlage des globalen kapitalistisch-patriarchalen Geschlechterverhältnisses: von Weiblichkeit und Männlichkeit, wie wir sie kennen, und der Zurichtung zu Cis- und Heterosexualität. Je nach den konkreten sozioökonomischen und sozialpsychischen Rahmenbedingungen in verschiedenen Ländern oder Milieus können Frauen in variierendem Grad an den Freiheiten, aber auch am Gewaltpotential des bürgerlichen Subjekts teilhaben. Wenngleich diese Faktoren variieren, so gilt doch überall: Die Frauenverachtung des kapitalistischen Patriarchats kulminiert in der Vernichtung weiblicher Subjekte, die sich zu viel Subjektivität anmaßen.
Vergleicht man die beiden Morde, werden die großen Unterschiede hinsichtlich weiblicher Selbstbestimmung und der Sanktionierung patriarchaler Gewalt deutlich. Ehrenmorde, wie im Fall Romina Ashrafis, sind eine bestimmte Art von Femiziden. Sie werden von einem politischen und religiösen System bedingt, in dem die gesellschaftliche Geltung eines Mannes eng damit zusammenhängt, dass er die Kontrolle über die von ihm abhängigen Frauen und Kinder der Familie bewahrt. Wenn Frauen keine vollwertigen Rechtssubjekte sind, gibt es für sie kaum Alternativen, einer belastenden häuslichen Situation zu entkommen, als sich in die Obhut eines anderen Mannes zu begeben. Dass diese Hoffnung auf Entkommen häufig mit tiefen Gefühlen wie Verliebtheit und Begehren verbunden ist, zeigt die libidinöse Verflechtung des weiblichen Subjekts mit der patriarchalen Dominanz, ohne die die Herrschaft der Ehemänner und Väter nicht möglich wäre. Diese Verstrickung zu reflektieren, ist äußerst schmerzhaft: für Feministinnen überall auf der Welt.
Während ihr Verlobter wahrscheinlich juristisch nichts zu befürchten hat – im Iran ist es nicht verboten, eine 13-Jährige zu ehelichen –, muss Rominas Vater mit einer Haftstrafe von drei bis zehn Jahren rechnen. Laut einem Bericht der New York Times erkundigte er sich vor dem Mord bei einem Anwalt nach der erwartbaren Strafe. Nach dem Vollzug stellte sich Reza Ashrafi, das Mordinstrument in der Hand, den Behörden. Die Wiederherstellung seiner Ehre war dem Täter folglich wichtiger ist als die zu erwartende Gefängnisstrafe. Derart brachiale Ehrvorstellungen funktionieren aber nur, wenn das soziale Umfeld des Täters die Ansicht teilt, dass eine Tochter, die ihren Vater ohne dessen Zustimmung verlässt, getötet werden dürfe oder müsse. Hierzulande können Frauenmörder zwar mit der Psychologisierung und Relativierung ihrer Taten rechnen – nicht aber mit offener Zustimmung.
Der Subjektstatus der Frauen im globalen kapitalistischen Patriarchat ist daran erkennbar, dass alle bürgerlichen Rechtssysteme die Tötung von Frauen verbieten und – theoretisch – nach demselben Maß bestrafen wie den Mord an einem Mann. Die Instabilität des weiblichen Subjektstatus offenbart sich darin, dass dieselbe Gesellschaftsform Männer im Krisen- oder Extremfall zum Femizid befähigt. In diesen Fällen stabilisiert sich die männliche Subjektivität darüber, dass Kränkung und Kontrollverlust mit der Auslöschung eines weiblichen Subjekts vergolten werden. Der Täter erkennt der kränkenden Frau, eben noch geliebte Partnerin oder Tochter und (im westlichen Patriarchat) gleichberechtigte Staatsbürgerin, das fundamentale Recht auf Leben ab. Es wird dem Anspruch des männlichen Subjekts auf Herrschaft, auf ungestörte Verdrängung seiner Abhängigkeit von der reproduktiven Arbeit der Frauen untergeordnet. Der gesetzlich garantierte Subjektstatus der Frauen wird – ähnlich wie derjenige von geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten und von Nichtweißen – immer wieder zugunsten des männlichen Subjekts zurückgenommen. Das zeigt sich auch darin, dass die tatsächlichen Strafen für einen Femizid in vielen Fällen niedriger ausfallen als für andere Morde; und dass das Strafmaß auf eine Weise begründet wird, die den Täter begünstigt und das Opfer nachträglich beschuldigt.
Auch in Deutschland werden Frauenmörder milder bestraft als andere Mörder. Häufig sehen Richter_innen und Staatsanwält_innen keines der Merkmale erfüllt, die den Tatbestand des Mordes rechtfertigen würden: etwa niedere Beweggründe oder Heimtücke. Laut einem wegweisenden Urteil des Bundesgerichtshofs von 2008 ist eine sogenannte Trennungstötung nicht durch niedere Beweggründe motiviert, wenn „die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will“. Leonie Steinl vom Deutschen Juristinnenbund attestiert diesem Urteil zu Recht eine „patriarchale Besitzkonstruktion“. Das Mordmerkmal der Heimtücke wird festgestellt, wenn das Opfer dem Täter gegenüber „arg- und wehrlos“ ist. Jedoch gehört es zu den Eigenheiten patriarchaler Gewalt, dass dem Femizid oft jahrelange Misshandlung in der Partnerschaft und nach der Trennung vorausgeht und die Frau häufig in Angst vor ihrem späteren Mörder lebt. Die Aktivistin Kristina Wolff, die sich für einen Femizid-Paragraphen im deutschen Strafrecht engagiert, prangert den Zynismus an, einer Ermordeten zu unterstellen, sie hätte doch ahnen können, dass der Exmann ihr nach dem Leben trachtet. Anders als Reza Ashrafi plädieren Frauenmörder in Deutschland bzw. ihre AnwältInnen häufig auf Affekt und Alkoholeinfluss als strafmildernde Faktoren – und kommen meist mit dem Urteil „Totschlag“ davon. In der Argumentation mit dem Affekt, also dem Täter als eigentlichem Opfer, und mit dem Fehlverhalten der Frau, die unabhängige Entscheidungen getroffen hat, lebt unterschwellig die Ansicht weiter, dass die Wiederherstellung verletzter männlicher Ehre eine verständliche Sache sei. Hier zeigen sich die strukturellen Ähnlichkeiten in der Ahndung von Femiziden. In Deutschland schlagen sie sich in einer Gesetzeslage nieder, die über keine geeigneten Kategorien verfügt, um patriarchale Gewalt zu erfassen, und in einer Rechtsprechung, die patriarchale Denkweisen offenbart.
Unter allen Frauenmorden sind es allein die Ehrenmorde, die in der deutschen Justiz und den deutschen Medien zuverlässig als Morde verhandelt werden und hinter denen man frauenfeindliche Motive vermutet statt einfach privates Unglück. Der Blick auf die eigenen patriarchalen Schieflagen ist hierzulande derart verstellt, dass die rassistische Abwehr der Drohung, die alle Frauen meint, sogar vor der feministischen Diskussion nicht automatisch haltmacht. Daher sollte der Begriff des Ehrenmords streng analytisch und in einem femizidkritischen Kontext gebraucht werden – im Bewusstsein der rassistischen Instrumentalisierung, die damit betrieben wird.
Im Iran unterliegen die Gesetze dem islamischen Gesetzbuch, der Scharia, und werden je nach Auslegung interpretiert. Die milde Strafe, die Romina Ashrafis Vater erwartet, ist als Kompromiss zwischen Bestrafung und Billigung des Femizids zu betrachten. Interessant ist, dass der Fall nicht nur unter Gegnern des islamistischen Regimes Aufsehen erregte. Überregionale Medien berichteten darüber; Präsident Hassan Rohani sowie Vizepräsidentin Masumeh Ebtekar, zuständig für Frauen und Familie, kündigten eine eingehende Untersuchung des Falls sowie härtere Strafen für Ehrenmorde an. Vielen KritikerInnen galt der Mord an Romina Ashrafi als Symbol des gesellschaftlichen Rückstands im Iran. Der öffentliche Schock, den er auslöste, zeugt von Auflehnung gegen die anti-bürgerliche Verfasstheit der Islamischen Republik, die in der wortwörtlichen Orientierung an der massiv frauenfeindlichen Scharia offenbar wird. Die exiliranische Frauenrechtlerin Shadi Sadr schrieb, der Mord mache deutlich, dass die Scharia-orientierte Rechtsprechung „unnormal“ sei und der Staat keinesfalls die Tötung von Frauen und Kindern dulden dürfe. In den Social Media prangerten iranische Frauen im Zusammenhang mit dem Femizid die weitverbreitete häusliche Gewalt an. Auch sie thematisierten die religiös begründete mangelnde Rechtssubjektivität von Frauen im Iran, die in auffälligem Widerspruch dazu steht, dass viele Frauen sehr gut ausgebildet und beruflich erfolgreich sind und sogar Staatsämter bekleiden. Auch die Sittenpolizei, die Romina Ashrafi verhaftete und nach Hause zurückbrachte, behandelte sie nicht als mündige Bürgerin, die nach eigenem Willen handelt, und genauso wenig als schutzbedürftige Jugendliche aus einem gewalttätigen Elternhaus. Gemäß ihrem islamistischen Auftrag erklärte sie das Mädchen zur unmoralischen Verführerin und lieferte sie der familiären Gerichtsbarkeit aus – trotz Rominas Warnungen, dass ihr Vater mehrmals gedroht habe, sie zu töten. Das Frauenbild, das dieser Institution zugrunde liegt, schadet Frauen und Mädchen erheblich mehr als etwa die Leitlinien deutscher Jugendämter, die sich in einem vergleichbaren Fall der jungen Frau angenommen und den Femizid vielleicht verhindert hätten.
Der Vergleich der Umstände, unter denen die Morde an Myriam Z. und Romina Ashrafi stattgefunden haben, zeigt: Die Vernichtungsdrohung gegen das anmaßende weibliche Subjekt meint alle Frauen, ist aber, abhängig von den konkreten sozioökonomischen Bedingungen, mehr oder weniger wirkmächtig. Um Femizide besser zu verstehen und zu bekämpfen, müssen Feministinnen die Lebens- und Handlungsmöglichkeiten von Frauen überall auf der Welt auf Gleichheit und Differenz hin analysieren. Der jeweilige Stand der bürgerlichen Emanzipation der Frau darf weder über- noch unterschätzt werden. Die sorgfältige Auseinandersetzung mit den Hintergründen von Femiziden verhindert, sich angesichts frauenrechtlicher Standards, die uns als selbstverständlich erscheinen, in falscher Sicherheit zu wiegen: Sie sind nicht nur vom gegenwärtigen antifeministischen Rückschritt bedroht, sondern konstitutiv unzuverlässig.
Auch Religionen als frauenfeindliche, mitunter tödliche gesellschaftliche Kräfte müssen in der Femizidforschung thematisiert werden. Das Nicht-zur-Sprache-Bringen der Spezifika von Ehrenmorden überlässt das Anprangern dieser Femizide den Rechten, die längst einen antimuslimisch-rassistischen Pseudofeminismus in Stellung gebracht haben.
In Deutschland steckt die Debatte um Femizide noch in den Anfängen. Aus einer Perspektive feministischer Theoriebildung geht es mir nicht darum, Begriffsdefinitionen zu setzen, Deutungshoheit zu beanspruchen oder Slogans festzuzurren – sondern einen Beitrag zu einer anstehenden Debatte zu leisten. Insofern möchte ich diese Überlegungen als Arbeitshypothesen verstanden wissen, die weiter diskutiert und kritisiert werden können. Trotz der Drastik und Dringlichkeit des Forschungsgegenstands sollten wir keinen vorschnellen Konsens oder eine „Umarmung aller Feministinnen“ (von der etwa das Transnationale feministische Manifest schwärmt) erwarten. Eine kontroverse feministische Diskussion kann den globalen Kampfbegriff Femizid schärfen: durch die vergleichende Analyse der Zumutungen patriarchaler Weiblichkeit. Diesem Ansatz zufolge können wir im Sinn einer transnationalen feministischen Solidarität sagen, dass der Mord an Romina Ashrafi ebenso mitten unter uns geschehen ist wie der an Myriam Z.